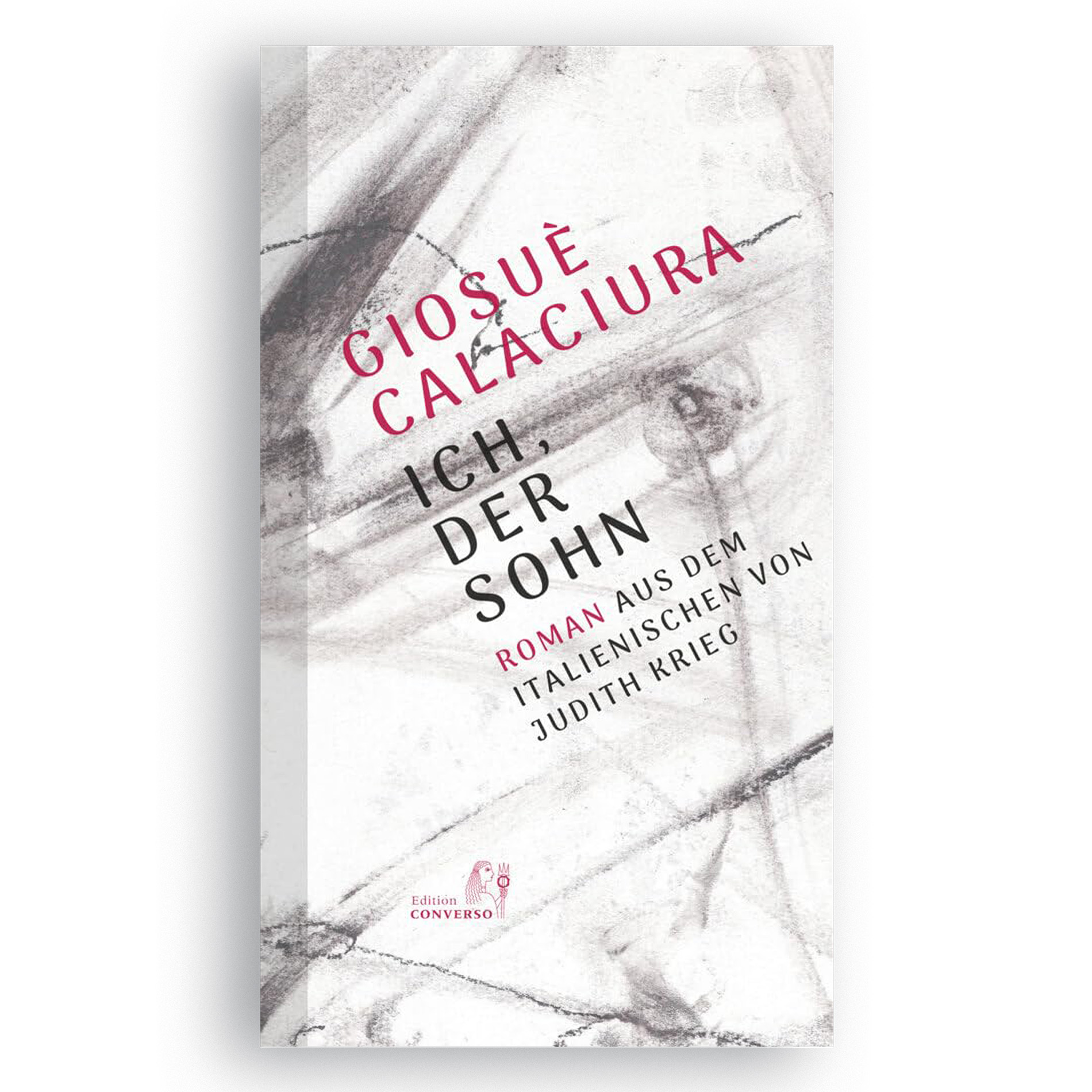Ich, der Sohn
Lesenswert
Giosuè Calaciura: Ich, der Sohn. Roman. Aus dem Italienischen von Judith Krieg. Karlsruhe: Edition Converso 2024, 24,00 €; ISBN 978-3-949558-20-7.
Ausleihbar im Bestsellerregal in der Medienstelle
Der Protagonist, der in Giosuè Calaciuras ungewöhnlichem Roman aus der Ich-Perspektive erzählt, ist kein Geringerer als der berühmteste „Sohn“, der je gelebt hat: Es ist Jesus selbst, der hier redet, leidet, liebt. Bei Calaciura ist er gerade dreißig und befindet sich also in jenem Alter, in dem der historische Jesus der Überlieferung nach erstmals an die Öffentlichkeit getreten sein soll.
Doch der Jesus des Romans richtet sich nicht an einen bestimmten Adressaten, schon gar ausdrücklich nicht an die Öffentlichkeit, er scheint zu sich selbst zu sprechen, sich selbst noch einmal die Entscheidungen und die Krisen seines Lebens vor Augen zu führen, all das Leid und den Verrat und die jahrelange Suche nach seinem Vater. Die biblischen Erzählungen spielen dabei eine nicht unerhebliche, aber doch keine primäre Rolle. Calaciura spielt vielmehr mit den Referenztexten und entwirft eine Jesusfigur, die gegen den Strich gebürstet ist. Er verfremdet bekannte Episoden aus Jesu Leben, dichtet so viel hinzu, das die biblischen Bezüge nurmehr marginal erscheinen, und negiert konsequent jeglichen vertikalen Transzendenzbezug, ja mehr noch: Er konterkariert das traditionelle Jesusbild.
Die Geburt als wunderbares Ereignis
Dazu einige Beispiele: Calaciuras Jesus wurde zwar unter wunderbaren Umständen geboren, doch die Umstände erscheinen allein deshalb wunderbar, weil jede Mutter – so die prosaische Erklärung - die Geburt ihres Kindes als wunderbares Ereignis empfindet. Calaciuras Jesus Jesus wandelt über das Wasser, aber nur im Traum. Calaciuras Jesus kritisiert den Tempelbetrieb, der Sühnopfer für Geld anbietet, und bedient sich doch seiner Infrastruktur zum eigenen Vorteil, indem er sich als Vermittler für religiöse Dienstleistungen einspannen lässt und dafür heimlich einen zusätzlichen Betrag erhebt. Calaciuras Jesus rettet Judas vor seinen Verfolgern, indem er ihn nicht verrät. Und nicht zuletzt: Calaciuras Jesus hadert mit Gott, lacht im Gottesdienst und erklärt sich zum Atheisten. Sein Vater, daran lässt er keinen Zweifel, ist Josef, ein Mensch aus Fleisch und Blut – und doch ein Vater, der diesen Namen nicht verdient. Denn er entzieht sich seiner Pflichten, verschwindet aus dem Dorf und lässt seine Frau und seinen Sohn allein zurück: „Mein Vater, mein Vater, warum hast Du mich verlassen?“
Das wohl eindrucksvollste Symbol
Der Jesus des Romans begnügt sich indes nicht mit einer Klage. Er beschließt, seinen Vater zu suchen und reist deshalb durch Israel – nicht als Prediger, sondern gleichsam als Identitätssucher, teilweise als Mitglied einer Gauklergruppe, zu der auch Delia gehört, „seine erste Liebe“.
Sie ist wunderschön und hat doch einen Makel: Eine lässliche Narbe durchkreuzt ihre Wange. Dieses schöne und zugleich entstellte Gesicht ist das vielleicht eindrucksvollste Symbol der vielen Ambivalenzen des Romans, zu denen z.B. gehört, dass Jesus seinen Vater sucht und sich doch erst fern von seiner Familie völlig frei fühlt. Auch Delia selbst ist ein ambivalenter Charakter. Sie liebt und verrät Jesus. Und ihre Narbe ist zugleich körperlicher Makel und Zeichen der Ermächtigung, eine „Freiheitsnarbe“, die sie sich beigebracht hat, um von ihren Eltern nicht als Ehefrau an einen Tyrannen verschachert zu werden.
Als Narbengesicht zählt Delia zu den vielen Gezeichneten des Romans: Menschen, die körperlich versehrt sind wie der Hirte, der sich bei Jesu Geburt den Oberschenkel durchbohrt hat, oder auch Jesus selbst, der sich unterwegs ebenfalls eine markante Verletzung am Bein zuzieht. Versehrt, von der Schwere des Lebens gezeichnet, sind die Figuren allerdings auch innerlich, psychisch. Die Welt, die Calaciuras Jesus beschreibt, ist von schlimmster Gewalt gekennzeichnet. In ihr bilden sich unter den Menschen allenfalls kurzfristige Allianzen, die rasch ins Gegenteil umschlagen können. Jesus hat deshalb nicht nur den Glauben an Gott, sondern auch den an die Menschen verloren.
Er selbst hat auf einschneidende Art erlebt, dass sie sich gegenseitig die Freiheit nehmen und die Mitmenschen für eigene Zwecke einzuspannen versuchen. Denn Delia, die einst geliebte Tänzerin, hat Jesu Geschichte. zu einer messianischen Erzählung ausgeschmückt und um des eigenen Profits willen öffentlich erzählen lassen. Sie hat Jesus, wie es im Roman heißt, „ans Kreuz der Gauklergeschichte“ genagelt.
Den traditionellen Fixierungen entkommen
Gegen dieses Kreuz schreibt auch Calaciura an. Er möchte den traditionellen Fixierungen der Jesusgeschichte entkommen, indem er uns einen anderen, schillernden, verstörenden Jesus präsentiert, der keineswegs sich selbst für auserwählt hält, sondern Johannes. Dabei schießt er bisweilen über des Ziel hinaus, etwa wenn er andeutet, Jesus sei der Sohn eines römischen Soldaten, der Maria vergewaltigt habe. Sein sprachmächtiger Roman ist gleichwohl faszinierend. Er vermag es, auf eine ganz spezifische Art zu irritieren und wirkt trotz seines historischen Settings beinahe zeitlos. Denn er ist nichts anderes als eine Erzählung darüber, was Menschen einander antun können, im Positiven und im Negativen, und welche Konsequenzen sich daraus für Identität, Menschenbild und Weltzugang ergeben. Kurzum: Calaciuras Roman ist sehr geeignet, das Gespräch darüber zu eröffnen, wer Jesus für uns heute ist. Eine radikal andere, von religiösen Deutungen abgelöste Hintergrundfolie kann dieses Gespräch nur beflügeln.
Alexander Schüller